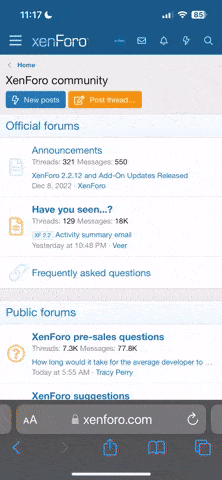Trotz der Allgegenwärtigkeit des Meereswassers werde ich erst jetzt eines Durstes gewahr, der sich bereits als ein Gefühl zweier den Hals umspannender, zudrückender Hände bemerkbar macht.
Ich verwerfe den Gedanken auf ein erlösendes Getränk; zu schön ist der Anblick sich reflektierender Sonnenstrahlen auf der sich leicht bewegenden Wasseroberfläche.
Diese unendliche Weite der sich vor mir erstreckenden Urgewalt ist so wundervoll, - doch wie beschreibt man Empfindungen für die Einzigartigkeit von Schönheit, Liebe, Hass, Farben... ?
Wie die Farbe dieses Elements beschreiben, die sich mit den Farbtönen des sich im Wasser spiegelnden Himmels vereint?
Wie beschreiben, was einem die Summe aus Sehen, Schmecken, Riechen, Hören und Fühlen, vermischt mit dem, was unseren Erfahrungen entspricht, vermittelt?
Ich gebe mich all dem hin, sauge es in mich hinein, erfreue mich dessen, was mich überwältigt, - dessen, was das Leben lebenswert macht.
Wie viele Sonnenuntergänge hatte ich in meinem Leben schon sehen können, doch, so bitter es auch klingt, erst jetzt, vom Meer aus betrachtet, offenbarte sich mir das tatsächliche Ausmaß dieses Ereignisses.
Gut ein Drittel des rotglühenden Feuerballs ist bereits am Horizont verschwunden; verheißungsvoll verlässt er mich mit einem Abschiedsgruß, der sich von Purpur bis hin zu einem leuchtenden Gelb über mir zeichnet.
Bei dem Anblick des Glitzerns und Funkelns fühle ich mich wieder zurückversetzt in die Zeit meiner Jugend, als mir träumen, ein Traum und die Erfüllung eines Traumes noch mehr bedeuteten, als das Abwägen von dem was ist, was sein könnte und was niemals sein wird.
Ich sehe ein riesiges Feld, ein Feld sich so weit hinziehend, wie das Auge schauen kann.
Angefüllt mit Tausender bunter Blumen, deren schillernde Farben das Sonnenlicht einzusaugen scheinen, um es dem Betrachter noch schwerer zu machen, sich ihnen entziehen zu können.
Ich weiß noch ganz genau, wie ich vor diesem Feld stand, unfähig die Augen zu schließen, voll Ehrfurcht erstarrt für eine schier endlose Zeit.
Irgendwann zog ich meine Schuhe und Strümpfe aus, stopfte alles in meinen Beutel und wagte zwei Schritte in das Feld.
Ein wenig piekste es unter meinen Fußsohlen, ein wenig kitzelte es.
Manche der Gräser und Blumen reichten mir bis zu den Schultern, und als ich ein paar weitere Schritte in das Feld hinaus getan hatte, konnte ich außer ihnen auch nichts mehr von der Straße sehen.
Doch mein Vater hatte mir beigebracht, mich an der Sonne und den Sternen zu orientieren, so dass ich meiner Freude freien Lauf ließ und begann, mich um mich selbst zu drehen.
Erst sehr langsam, dann immer schneller und schneller, laut mein Glück hinausschreiend, auf das es die Welt mit mir teile.
Schwindlig geworden fiel ich auf den Boden, und eine kleine Zeit später erhob ich mich und begann zu rennen, wie ich noch nie gerannt war. Weiter und weiter in das Feld hinein bis ich nicht mehr konnte.
Dann legte ich mich hin, schloss die Augen und lauschte einfach nur den Stimmen der Insekten und des Windes, der über das Feld wehte.
Es war so wunderschön gewesen, dass ich mich noch heute, sehr viel später, daran erinnern konnte, als sei es gestern gewesen.
Ich merke, wie sich unmerklich ein Lächeln auf mein Gesicht geschlichen hat, während der Gedanken an diese Zeit.
Die Sonne ist indes ein gutes Stück tiefer hinter dem Horizont versunken; sie hat nun ein tiefes Orange und lässt ihre Umgebung in Abstufungen davon erscheinen.
Aber jeder ist ein Gefangener seiner selbst, und ich habe gemerkt, dass mich solche Momente träumen lassen, - träumen lassen von Dingen, die vielleicht nie passiert sind, Dingen, die nicht hätten passieren dürfen, Dingen, die so einschneidend waren, dass sie mich für immer geprägt haben.
Manche davon klein und zunächst unbedeutend, andere stärker.
Und träumen lassen von den Menschen, die ich einst kannte, bewunderte und liebte, oder denen ich nie geschafft näher zu kommen.
Ich schaue wieder bewusst auf das Meer, ohne an etwas Bestimmtes dabei zu denken.
Vertrauend auf die hypnotische Wirkung, die es auf mich hat.
Tatsächlich lässt mich dies Beständige auf und ab der Wellen bald merken, wie sich eine weitere Erinnerung meiner bemächtigt.
Ich versuche mich dem nicht zu widersetzen, versuche die Augen geöffnet zu halten, um meinen Träumereien Vorschub zu leisten.
Bald sehe ich nur noch die Wellenbewegungen, die ich in Gedanken mit der Hand nachfahre.
Ich verwerfe den Gedanken auf ein erlösendes Getränk; zu schön ist der Anblick sich reflektierender Sonnenstrahlen auf der sich leicht bewegenden Wasseroberfläche.
Diese unendliche Weite der sich vor mir erstreckenden Urgewalt ist so wundervoll, - doch wie beschreibt man Empfindungen für die Einzigartigkeit von Schönheit, Liebe, Hass, Farben... ?
Wie die Farbe dieses Elements beschreiben, die sich mit den Farbtönen des sich im Wasser spiegelnden Himmels vereint?
Wie beschreiben, was einem die Summe aus Sehen, Schmecken, Riechen, Hören und Fühlen, vermischt mit dem, was unseren Erfahrungen entspricht, vermittelt?
Ich gebe mich all dem hin, sauge es in mich hinein, erfreue mich dessen, was mich überwältigt, - dessen, was das Leben lebenswert macht.
Wie viele Sonnenuntergänge hatte ich in meinem Leben schon sehen können, doch, so bitter es auch klingt, erst jetzt, vom Meer aus betrachtet, offenbarte sich mir das tatsächliche Ausmaß dieses Ereignisses.
Gut ein Drittel des rotglühenden Feuerballs ist bereits am Horizont verschwunden; verheißungsvoll verlässt er mich mit einem Abschiedsgruß, der sich von Purpur bis hin zu einem leuchtenden Gelb über mir zeichnet.
Bei dem Anblick des Glitzerns und Funkelns fühle ich mich wieder zurückversetzt in die Zeit meiner Jugend, als mir träumen, ein Traum und die Erfüllung eines Traumes noch mehr bedeuteten, als das Abwägen von dem was ist, was sein könnte und was niemals sein wird.
Ich sehe ein riesiges Feld, ein Feld sich so weit hinziehend, wie das Auge schauen kann.
Angefüllt mit Tausender bunter Blumen, deren schillernde Farben das Sonnenlicht einzusaugen scheinen, um es dem Betrachter noch schwerer zu machen, sich ihnen entziehen zu können.
Ich weiß noch ganz genau, wie ich vor diesem Feld stand, unfähig die Augen zu schließen, voll Ehrfurcht erstarrt für eine schier endlose Zeit.
Irgendwann zog ich meine Schuhe und Strümpfe aus, stopfte alles in meinen Beutel und wagte zwei Schritte in das Feld.
Ein wenig piekste es unter meinen Fußsohlen, ein wenig kitzelte es.
Manche der Gräser und Blumen reichten mir bis zu den Schultern, und als ich ein paar weitere Schritte in das Feld hinaus getan hatte, konnte ich außer ihnen auch nichts mehr von der Straße sehen.
Doch mein Vater hatte mir beigebracht, mich an der Sonne und den Sternen zu orientieren, so dass ich meiner Freude freien Lauf ließ und begann, mich um mich selbst zu drehen.
Erst sehr langsam, dann immer schneller und schneller, laut mein Glück hinausschreiend, auf das es die Welt mit mir teile.
Schwindlig geworden fiel ich auf den Boden, und eine kleine Zeit später erhob ich mich und begann zu rennen, wie ich noch nie gerannt war. Weiter und weiter in das Feld hinein bis ich nicht mehr konnte.
Dann legte ich mich hin, schloss die Augen und lauschte einfach nur den Stimmen der Insekten und des Windes, der über das Feld wehte.
Es war so wunderschön gewesen, dass ich mich noch heute, sehr viel später, daran erinnern konnte, als sei es gestern gewesen.
Ich merke, wie sich unmerklich ein Lächeln auf mein Gesicht geschlichen hat, während der Gedanken an diese Zeit.
Die Sonne ist indes ein gutes Stück tiefer hinter dem Horizont versunken; sie hat nun ein tiefes Orange und lässt ihre Umgebung in Abstufungen davon erscheinen.
Aber jeder ist ein Gefangener seiner selbst, und ich habe gemerkt, dass mich solche Momente träumen lassen, - träumen lassen von Dingen, die vielleicht nie passiert sind, Dingen, die nicht hätten passieren dürfen, Dingen, die so einschneidend waren, dass sie mich für immer geprägt haben.
Manche davon klein und zunächst unbedeutend, andere stärker.
Und träumen lassen von den Menschen, die ich einst kannte, bewunderte und liebte, oder denen ich nie geschafft näher zu kommen.
Ich schaue wieder bewusst auf das Meer, ohne an etwas Bestimmtes dabei zu denken.
Vertrauend auf die hypnotische Wirkung, die es auf mich hat.
Tatsächlich lässt mich dies Beständige auf und ab der Wellen bald merken, wie sich eine weitere Erinnerung meiner bemächtigt.
Ich versuche mich dem nicht zu widersetzen, versuche die Augen geöffnet zu halten, um meinen Träumereien Vorschub zu leisten.
Bald sehe ich nur noch die Wellenbewegungen, die ich in Gedanken mit der Hand nachfahre.